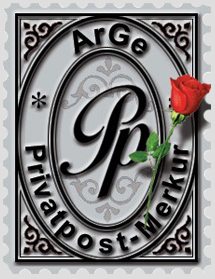Über unseren Verein
Die Arbeitsgemeinschaft Privatpost wurde am 18. Juni 1983 als Studiengruppe innerhalb der Poststempelgilde „Rhein-Donau“ e.V. ins Leben gerufen. Mit dieser Gründung wurde der Tiefschlaf der Deutschen Privatpost, der seit der Beendigung der aktiven Vereinsarbeit des Deutschen Privatpostmarken Sammlervereins „Merkur“ im Jahr 1964 herrschte, ein Ende gesetzt. Dieser Bereich der deutschen Post- und Gewerbegeschichte erlebte eine Wiederbelebung.
Neben den klassischen und modernen deutschen Privatpostanstalten interessieren wir uns auch für Entwicklungen in anderen Ländern, etwa die Byposten in den nordischen Staaten sowie die Stads- und Streekposten in den Niederlanden. Alles rund um das Thema nehmen wir auf.
Dreimal im Jahr erhalten unsere Mitglieder die Zeitschrift „Privatpost“ mit einem Umfang von rund 200 Seiten. Darüber hinaus veröffentlichen wir Sonderschriften mit ausführlichen Abhandlungen zu speziellen Themen, die ebenfalls kostenlos an unsere Mitglieder verteilt werden.
Seit Dezember 2000 erscheint zudem die Zeitschrift „Merkur-Briefe“. Diese Publikation ist in Deutschland die erste und bislang einzige Zeitschrift, die sich ausschließlich mit der modernen privaten Briefbeförderung beschäftigt, worauf wir äußerst stolz sind. Im Jahr 2022 feiert die Arbeitsgemeinschaft Privatpost Merkur ihr 75-jähriges Bestehen.
Bis zum Jahr 1900 wurden Privatpostmarken von Sammlern gleichwertig zu den Marken der Reichspost gesammelt. Ein nahezu hundert Jahre währendes Postmonopol begann zu bröckeln. Mit der Neufassung des Postgesetzes vom 1. Januar 1998 wird ein neues Kapitel privater Briefbeförderung aufgeschlagen.
Der Verein Merkur wurde 1946 gegründet; das Gründungsprotokoll liegt vor.
Die klassische Privatpost
Die gesetzliche Genehmigung von Privatpostanstalten war eine Konsequenz aus dem Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866. Preußen konnte nach seinem Sieg mehrere deutsche Staaten annexieren, darunter das Königreich Hannover, die Herzogtümer Schleswig und Holstein sowie das Kurfürstentum Hessen-Kassel und die Freie Stadt Frankfurt am Main. Auch die Posthoheit der Fürsten von Thurn und Taxis blieb bestehen, obwohl sie keinen eigenen Staat hielten, jedoch zahlreiche Niederlassungen wie das Oberpostamt in Frankfurt am Main hatten. Andere selbständige deutsche Staaten wurden von Preußen teils sanft, teils mit Nachdruck dazu angeregt, dem Norddeutschen Bund beizutreten und auf ihre eigenen Posthoheiten zu verzichten. Dies machte ein neues, für alle deutschen Staaten verbindliches Postgesetz notwendig.
Bereits bei den Beratungen zu diesem Gesetz wurde gefordert, staatliche Postmonopole abzuschaffen. Im Postgesetz des Norddeutschen Bundes, das am 2. November verabschiedet wurde, fand sich in § 1 der Vergleich: Die Beförderung 1) aller versiegelten, zugenähten oder in sonstiger Weise verschlossenen Briefe, 2) aller politischen Zeitungen, die mehr als einmal pro Woche erscheinen, gegen Bezahlung von Orten mit einer Postanstalt zu anderen Orten mit einer Postanstalt im Inland oder Ausland auf andere Art als durch die amtliche Post, ist untersagt. Damit war jegliche privatwirtschaftliche Beförderung innerhalb der Ortsgrenzen ohne Einschränkung erlaubt, während nur verschlossene Briefe dem staatlichen Monopol unterlagen. Diese Regelungen wurden unverändert ins Reichspostgesetz vom 28. Oktober 1871 integriert.
Die erste Privatpost, die sich auf dieses Gesetz berufen konnte, war die Brief- und Druckschriftenexpedition von J. J. Schreiber in Berlin, die von Mai 1873 bis August 1874 operierte. Schreiber scheiterte allerdings an der damals herrschenden Wirtschaftskrise. Erst zehn Jahre später hatte sich die wirtschaftliche Lage so weit verbessert, dass sich erfolgversprechende Perspektiven für Privatposten boten, was sich auch in der Vielzahl neuer Briefbeförderungsunternehmen im Jahr 1886 zeigte. Wenige unseriöse Anbieter aus der Anfangszeit führten dann dazu, dass die Reichspost aggressive Kampagnen gegen alle privaten Postdienste initiierte und diese schließlich verleumdete, indem behauptet wurde, sie würden lediglich wegen einer „Lücke“ im Postgesetz existieren.
Nach langem, mühsamem Ringen – unter anderem mit dem Reichstag – gelang es der Reichspost schließlich, mit einem Gesetz vom 20. Dezember 1899 jede private Briefbeförderung mit Wirkung ab dem 1. April 1900 zu verbieten. Dieses Gesetz regelte unter anderem genau die Entschädigungen, die den betroffenen Unternehmern nach tatsächlichem Schaden und entgangenem Gewinn sowie für die Boten in Abhängigkeit von der Dauer ihrer Anstellung und Höhe ihres Einkommens gezahlt werden sollten, sofern sie nicht in den Dienst der Reichspost übernommen wurden. Boten, die seit 1886 bei der Privatpost beschäftigt waren, erhielten so Abfindungen von mehr als drei Jahresgehältern.
Die damals bestehenden drei deutschen Postverwaltungen zahlten insgesamt folgende Entschädigungen an Unternehmer und nicht übernommene Boten: Deutsche Reichspost 7.450.000 Mark, Kgl. Bayerische Post 440.000 Mark, Kgl. Württembergische Post 320.000 Mark – zusammen also etwa 8.200.000 Mark. Zudem wurden rund 740 Boten in den Dienst der Reichspost übernommen. Zum Vergleich: Gut 30 Jahre zuvor hatte der Fürst von Thurn und Taxis von Preußen einen Betrag von 3.000.000 Thalern erhalten. Nach der Währungsumstellung im Deutschen Reich am 1. Januar 1875 war dieser Betrag umgerechnet 9.000.000 Mark wert.
Für die Postkunden wurde am 1. April 1900, an dem Tag, an dem das Verbot der Privatposten in Kraft trat, der Tarif für Ortspostkarten von 5 auf 2 Pfennig gesenkt, jedoch nicht für Briefe und Ähnliches. An diesem Tag kamen die Marke MiNr. 52 und die Postkarte P44 des Deutschen Reiches heraus. Als diese Portoermäßigung am 1. Juli 1906 wieder aufgehoben wurde, entstanden neue Privatpostanstalten, die auf unterschiedliche Weisen versuchten, die Bestimmungen des erweiterten Postgesetzes zu umgehen. Die meisten dieser Anstalten, die nur in geringem Maße Freimarken herausgaben, schlossen häufig nach kurzen Zeiträumen, oft nach verlorenen Gerichtsverfahren, die von der Reichspost eingeleitet wurden.
Die moderne Privatpost
Fast ein Jahrhundert galt das uneingeschränkte Monopol der Staatspost. Erste Impulse zur Liberalisierung des Postsektors in der Europäischen Gemeinschaft gab es bereits 1989, doch erst 1992 legte die Europäische Kommission ein Grünbuch zur Entwicklung der Postdienste in einem Binnenmarkt vor. Fünf Jahre später, im Dezember 1997, wurde über die sogenannte Postrichtlinie entschieden, die reservierte Bereiche zur Aufrechterhaltung eines Universaldienstes für unbestimmte Zeit zuließ.
Im März 2002 billigte das Europäische Parlament einen Kompromiss des Ministerrates, der ab 2003 eine Freigabe der abgehenden Auslandspost vorsah und die Gewichtsgrenze des reservierten Bereichs auf 100 Gramm senkte. Ab 2006 sollte diese Grenze auf 50 Gramm reduziert werden, wobei kein Enddatum für das Postmonopol vorgesehen oder absehbar war. In der Praxis bedeutet dies, dass auch zehn Jahre nach Beginn der aktiven Phase der Liberalisierung ca. 65 % des Briefaufkommens und etwa 60 % des Umsatzes auf dem deutschen Postmarkt nach wie vor in den Händen der ehemaligen Staatspost liegen werden.